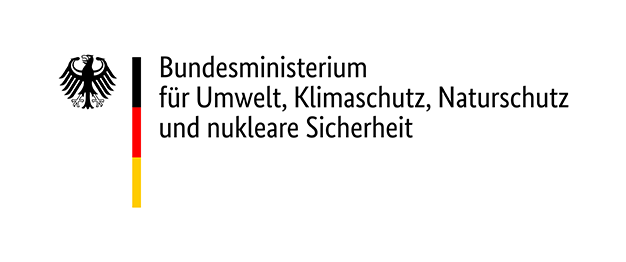Dr. Katja Lehmberg leitet die Gruppenarbeit des Winterkurses des Katholischen LandvolkHochschule Oesede
Bild: Dr. Anne-Kathrin Schneider-Hohenbrink
In der ersten Januarwoche fand eine spannende Veranstaltung im Rahmen des Winterkurses der Katholischen LandvolkHochschule Oesede statt, die sich ganz der Biodiversität in der Landwirtschaft widmete. Organisiert von F.R.A.N.Z.-Projektakteuren, wie dem Thünen-Institut und der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, erhielten 38 teilnehmende Junglandwirt*innen wertvolle Einblicke in die Bedeutung der Biodiversität für den ländlichen Raum.
Der Betriebsberater Hendrik Specht von der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft eröffnete den Tag mit einem Vortrag über die Rolle der Biodiversität in der Landwirtschaft. Anschließend stellten Anika Bosse und Dr. Anne Kathrin Schneider-Hohenbrink vom Thünen-Institut das F.R.A.N.Z.-Projekt vor und präsentierten einige der im Projekt erprobten Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität. In einer interaktiven Gruppenarbeit, geleitet von Dr. Katja Lehmberg vom Thünen-Institut, konnten die Teilnehmenden selbst ausprobieren, wie eine Biodiversitätsplanung auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aussehen könnte. In der Gruppenarbeit sollten auf vier verschiedenen Betrieben aus der Westfälischen Beratungspraxis sechs Maßnahmen verteilt und genauer betrachtet werden, darunter die im Projekt umgesetzten „Insektenwälle“, „Extensivgetreide“ und „Mehrjährige Blühstreifen“. Die Teilnehmenden zeigten dabei ein gutes Verständnis sowohl für die naturschutzfachlichen Aspekte als auch für die betrieblichen Faktoren, die bei der Planung und Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen eine Rolle spielen.
Am Nachmittag führte Hendrik Specht die Junglandwirt*innen über den F.R.A.N.Z.-Demonstrationsbetrieb von Landwirt Jürgen von Morsey-Picard. Hier hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich direkt vor Ort von den umgesetzten Biodiversitätsmaßnahmen zu überzeugen.
Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren durchweg positiv. Viele der Junglandwirt*innen brachten bereits erste Erfahrungen mit der Anlage von Biodiversitätsmaßnahmen (z. B. Blühstreifen) mit, die sie auf ihren eigenen Betrieben oder in der Ausbildung gesammelt hatten. Der Einblick in das F.R.A.N.Z.-Projekt und die hier repräsentierte Mischung aus Ökologie, Beratung, Ökonomie und betrieblichem Know-how wurde als besonders wertvoll erachtet. Die Teilnehmenden zeigten großes Interesse und stellten engagierte Fragen, was zu einem offenen und konstruktiven Austausch führte.
Die Kombination aus theoretischem Input und Exkursion in die Praxis, einschließlich einer Planwagenfahrt und Schneeballschlacht, sorgte für eine gelungene Abwechslung und einen unterhaltsamen Abschluss des Tages.
Darüber hinaus diente der Winterkurs der Katholischen LandvolkHochschule als wertvolle Plattform für den Austausch von Ideen und regte zahlreiche Diskussionen über wichtige Aspekte der Biodiversität in der Landwirtschaft an. Die Veranstaltung trägt dazu bei, die nächste Generation von Landwirten auf die zukünftigen Herausforderungen vorzubereiten.
Solche Formate sollten häufiger angeboten werden, um den Austausch und das Verständnis für Biodiversität in der Landwirtschaft weiter zu fördern und angehende Landwirte bestmöglich auf kommende Herausforderungen vorzubereiten. Falls Sie ein solches Projekt an Ihrer Schule umsetzen möchten, stehen wir Ihnen für weitere Informationen zu unseren verschiedenen F.R.A.N.Z.-Maßnahmen zur Verfügung.
Weitere Impressionen der Veranstaltung:
Die Junglandwirt*innen erproben sich in der Biodiversitätsplanung. Bild: Dr. Anne-Kathrin Schneider-Hohenbrink.
Die anschließende Besichtigung der Naturschutzmaßnahmen auf dem F.R.A.N.Z.-Demonstrationsbetrieb in Ostwestfalen-Lippe, hier wird der eingeschneite Insektenwall begutachtet. Bild: Dr. Anne-Kathrin Schneider-Hohenbrink.
Das F.R.A.N.Z.-Projekt wird gemeinsam von der Umweltstiftung Michael Otto und dem Deutschen Bauernverband geleitet und wissenschaftlich vom Thünen Institut, der Universität Göttingen und dem Michael-Otto-Institut im NABU begleitet. Die Förderung des Projekts erfolgt mit Mitteln der Landwirtschaftlichen Rentenbank mit besonderer Unterstützung des Bundesministeriums für Ernährung sowie durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.