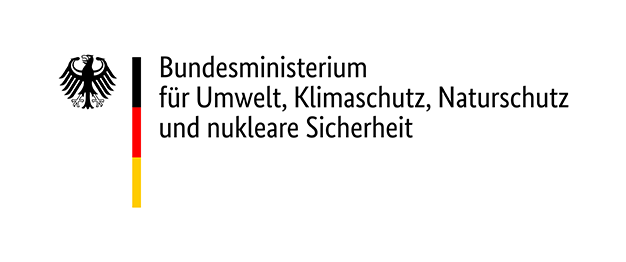Am 26. Mai 2025 fand ein Feldtag zu den Themen Biodiversität und Klimaschutz auf dem F.R.A.N.Z.-Betrieb in Ruhsam statt. Ausgerichtet wurde die halbtägige Veranstaltung vom HumusKlimaNetz und dem F.R.A.N.Z.-Projekt.
v.l.n.r. F.R.A.N.Z. Landwirte Friedhelm Dickow und Sebastian Dickow © Sophie Wolters

Erste Einführung in die Maßnahmen von Betriebsberaterin Dr. Claudia Kriegebaum © Dr. Claudia Kriegebaum
Im Rahmen des F.R.A.N.Z.-Projektes werden auf 10 deutschlandweit verteilten Demonstrationsbetrieben Naturschutzmaßnahmen umgesetzt, die dazu beitragen die Artenvielfalt zu erhöhen und zu fördern. Wichtig dabei ist, dass die Maßnahmen ökologisch wirksam, ökonomisch tragfähig und praxistauglich sind. Nach einer kurzen Vorstellung der Projektziele, erster Ergebnisse und der Projektkonstellation durch die Projektleitungen Dr. Anna Bobrowski (Deutscher Bauernverband) und Sophie Wolters (Umweltstiftung-Michael-Otto), ging es auf die Maßnahmenflächen. Bei der Begehung der Maßnahmen vor Ort, erklärte Dr. Claudia Kriegebaum von der Bayerischen KulturLandStiftung die Erfahrungen in der landwirtschaftlichen Praxis.
Zwei Maßnahmen, die hier besonders gute Erfolge aufweisen sind das blühende Vorgewende und das Getreide mit blühender Untersaat. Beide bieten einen dreifachen Gewinn: Eine Kleemischung aus 12 verschieden Kleearten ist zum Befahren geeignet, sorgt für Artenvielfalt, Bodenerosionsschutz, kann perfekt in der Biogasanlage verwerten werden und nach der Mahd nochmal Blüte zeigen. Auch Düngung ist hier nicht mehr nötig, da die Knöllchenbakterien des Klees eine gute Stickstoffanreicherung und eine verbesserte Bodenqualität durch ihre tiefen Wurzeln bieten.

Eine der sieben umgesetzten Maßnahmen: Extensivgetreide mit blühender Untersaat aus 12 verschiedenen Kleearten. © Dr. Claudia Kriegebaum
Eine weitere Maßnahme, die nicht nur für Insekten und Ackerwildkräuter wichtig ist, sondern auch der unter artenschutzstehenden Feldlerche ein Brut- und Nahrungshabitat bietet, sind die niedrigwüchsigen Blühstreifen mit gebietsspezifischen Wildkräutern. Dominik Himmler (Geschäftsführer der Bayerischen KulturLandStiftung) wies auf die Wichtigkeit einer gebietsheimischen Saatgutzusammenstellung hin, die eine lange Blüte und mehrjähriges Bestehen des Blühstreifens sicherstellt. Vor Ort konnte ein acht Jahre alter Blühstreifen begutachtet werden, der sich immer noch in einem blütenreichen und wenig vergrastem Zustand befindet. Aus der Praxis heraus sammelten Friedhelm Dickow und die ökologische Beratung die Erfahrung, dass eine Herbstaussaat sinnvoller als eine Frühjahrsaussaat ist. Die gebietsspezifischen Wildkräuter sind winterhart und können, ausgesät im Herbst, bereits ihre Rosetten ausbilden, wodurch die im Boden befindlichen Problemkräuter wie Ackerkratzdistel oder Melde im Frühjahr geringere Chancen haben, sich zu entwickeln.

Besichtigung eines Blühstreifens mit gebietsspezifischen Wildkräutern als Brut- und Nahrungshabitat für die unter artenschutzstehende Feldlerche. © Dr. Claudia Kriegebaum
Maßnahmen wie Blühstreifen oder Untersaaten bieten nicht nur Vorteile für die Artenvielfalt, sie leisten auch einen Beitrag zum Humusaufbau im Boden und damit zum aktiven Klimaschutz – denn Humus besteht zum Großteil aus Kohlenstoff, welcher der Atmosphäre entzogen wird. Wie wirkungsvoll diese Maßnahmen sind, zeigt der Betrieb durch die Teilnahme an einem weiteren Projekt, dem HumusKlimaNetz. Hierbei werden auf 150 Höfen in ganz Deutschland humusmehrende Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin untersucht. Das Projekt wird vom Deutschen Bauernverband und dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft betreut. Regionalkoordinator Lorenz Bücheler (Deutscher Bauernverband) wies während des Rundgangs auf die besondere Bedeutung der Wurzeln für den Humusaufbau hin. Besonders mehrjährige Blühstreifen böten demnach den Pflanzen die Möglichkeit, ein tiefes Wurzelsystem auszubilden und somit zum Humusaufbau beizutragen.
Lorenz Bücheler (Regionalkoordinator HumusKlimaNetz, DBV) eklärt die besondere Bedeutung der Wurzeln für den Humusaufbau an der Maßnahme: Wicken-Roggen. © Dr. Claudia Kriegebaum